
Ob mit „Sieben“, „Zodiac – Die Spur des Killers“ oder „Verblendung“, David Fincher betrachtete das makabre Serienkiller-Genre oft mit einem kühlen, analytischen Auge. Dabei verlor er allerdings nie die Spannung aus dem Auge. Mit der Netflix-Serie „Mindhunter“ kehrt er nun zu Altbewährtem zurück, betrachtet es allerdings aus einem relativ unbekannten und interessanten Blickwinkel.
Auch Netflix ist dem perfektionistischen Regisseur nicht fremd. Schließlich war es Fincher, der dem Streaming-Riesen seinen ersten eigenproduzierten Serienerfolg namens „House of Cards“ verschaffte. Die Realität scheint die Fiktion mit einem moralisch korrupten Präsidenten überholt zu haben. Höchste Zeit, dass Fincher zusammen und „Mindhunter“-Autor Joe Penhall für frisches Blut sorgen – im buchstäblichen und übertragenen Sinne. Die zehn Episoden der ersten Staffel beschäftigen sich aber nur sekundär mit der Jagd nach Serientätern, die das Amerika am Ende der 70er Jahre unsicher machten. Vielmehr untersucht „Mindhunter“ die Anfänge der Kriminalpsychologie innerhalb der FBI-Behörde, als es den Begriff „Serienkiller“ noch gar nicht gab.
„Mindhunter“ zeigt die Anfänge der Kriminalpsychologie

FBI-Agent Holden Ford (Jonathan Groff) arbeitet zunächst nicht gerade an vorderster Front, wenn es darum geht, psychopathische Killer zu schnappen. Stattdessen unterrichtet er an der FBI-Akademie in Virginia. Dennoch bleiben seine recht eigentümlichen Ideen für die Verbrechensbekämpfung auch in den oberen Etagen nicht unbeachtet. Anstatt Psychopathen und Mörder einfach wegzusperren und den Schlüssel wegzuwerfen, möchte er lieber herausfinden, was sich in deren Kopf abspielt. Dazu ist es notwendig, dass er die Hochsicherheitsgefängnisse der USA besucht und brutale Mörder auf äußerst unorthodoxe Weise interviewt.
Das Wissen und die psychologischen Profile, die er dabei extrahiert, möchte er auf andere Fälle anwenden. Es ist nicht verwunderlich, dass die Methodik zunächst auf Skepsis und Ressentiments innerhalb der Behörde stößt. Immerhin wird der FBI-Trainer (Holt McCallany) auf den jungen Newcomer aufmerksam. Zusammen machen sie sich auf die Reise in die psychologischen Untiefen und dunkelsten Phantasien, welche die US-amerikanische Mörderwelt zu bieten hat.
Verbrechensbekämpfung umkrempeln statt Serienkiller-Hatz
Hier geht es nicht unbedingt darum, in jeder Episode einem neuen Mörder das Handwerk zu legen, wie es in herkömmlichen Thriller-Serien meistens der Fall ist. Stattdessen versuchen die Protagonisten ein ganzes System der Kriminalitätsverfolgung umzukrempeln. Die Verhaltenspsychologin Wendy Carr (Anna Torv, bekannt aus der Mystery-Serie „Fringe“) soll der Unternehmung einen wissenschaftlichen und damit einen seriösen Touch verleihen.
[AdSense-A]
Seriösität ist auch dringend notwendig. Ford denkt nämlich nicht im Traum daran, sich an den vorgegebenen und trocken formulierten Fragenkatalog zu halten. Lieber gibt er eigene, erfundene oder reale Phantasien preis und bietet Details aus seinem Privatleben an. Nur so kann er die Monster im Gefängnis aus der Reserve zu locken. Dringt Ford also in die Köpfe der Psychopathen ein? Oder umgekehrt? „Mindhunter“ scheint beides anzudeuten, lässt die Frage aber während der gesamten 10 Stunden im Raum stehen. Der junge Agent geht stellenweise allerdings so rücksichtslos vor, dass er nicht nur die gesamte Ermittlungseinheit in Gefahr bringt, sondern auch einen Keil zwischen sich und seine Kollegen treibt.
David Fincher schickt in „Mindhunter“ einen Chorknaben auf Verbrecherjagd

Fincher fungiert hauptsächlich als ausführender Produzent, führte aber auch bei vier Episoden selbst Regie. Die gesamte Serie trägt jedoch seine Handschrift, nicht nur wenn es um die optische Gestaltung geht. Setdesign, Musik, Kostüme und Haarschnitte versetzen den Zuschauer zurück an das Ende der 70er Jahre. Alles bleibt dennoch äußerst subtil. Jede Szene ist vorsichtig arrangiert und in allen Episoden kommt Finchers Liebe zum Detail zum Vorschein. Der Regisseur mag es außerdem, gegen den Strich zu besetzen: So ergatterte der nervöse Jesse Eisenberg die Hauptrolle des Mark Zuckerberg in „Social Network“. Und so bewies Brad Pitt Mut zur Hässlichkeit in „Fight Club“.
In „Mindhunter“ ist es Jonathan Groff, der zunächst als Chorknabe seine Aufgabe beginnt und Schritt für Schritt seine dunklere Seite ans Tageslicht holt. Groffs kommerzieller Erfolg nahm mit der optimistischen Musical-Serie „Glee“ seinen Anfang. Später überzeugte er in der HBO-Serie „Looking“. Zuletzt begeisterte er vor allem das New Yorker Theaterpublikum als englischer King George III. in dem äußerst erfolgreichen Broadway-Musical „Hamilton“. Im unschuldigen Gesicht des jungen Schauspielers spiegelt sich Faszination, Intelligenz und gleichzeitig Naivität wieder während er mit seinen Untersuchungsobjekten spricht.
Ein „Mindhunter“ ist nur so gut wie seine Partner

Sein Partner Bill Tench, wunderbar lakonisch dargestellt von Holt McCallany, bevorzugt eine wesentlich zurückhaltendere, dafür aber skeptischere Herangehensweise. Immer wieder möchte er seinen jungen Schützling mit ruhiger Hand und einer wesentlich zynischeren Einstellung zurückhalten. Letztendlich kann er aber selbst nicht abstreiten, dass die ungewöhnliche Methodik in der Praxis ihre Wirkung zeigt. Die bekannte Figuren-Konstellation des alten Haudegen, der seinen jüngeren Partner an der kurzen Leine halten muss, dessen Methoden er jedoch immer wieder bei Vorgesetzten verteidigt, kann etwas klischeehaft anmuten. Sie eröffnet aber gleichzeitig Möglichkeiten für humorvolle sowie dramatische Dialoge und Spannungen. Die Ernsthaftigkeit des Geschehens driftet dabei allerdings nie ins Alberne oder Melodramatische ab.
Wunderbar in dieses Gespannt passt die australische Schauspielerin Anna Torv, um die es seit ihrer Hauptrolle in der beliebten Serie „Fringe“ wieder etwas still geworden ist. Als augenscheinlich glatte Wissenschaftlerin scheint sie hier noch etwas schwer fassbar. Torv ist allerdings eine dieser Schauspielerinnen, die immer viel mehr unter einer vermeintlich kühlen Oberfläche transportieren können.
Ernsthaft, nüchtern und mit intelligenten Dialogen, dennoch nichts für Zartbesaitete

Trotz des ein oder anderen humorvollen Intermezzos, beschäftigt sich „Mindhunter“ ernsthaft, nüchtern und mit intelligenten Dialogen mit der zugrunde liegenden und verstörenden Thematik. Basierend auf dem True Crime-Buch „Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit“, wird die Serie langsam erzählt und hält sich mit plumpen Spannungsmomenten zurück. Deswegen ist das Gezeigte aber nicht weniger beunruhigend, insbesondere weil sich ein großer Teil der erste Staffel mit dem überlebensgroßen und überraschend eloquenten Edmund Kemper (Cameron Britton) beschäftigt. Eine Figur, die auf einen wahren Serientäter basiert. Dieser beschreibt mit einer enervierende Ruhe seine Taten. Währenddessen baut sich zwischen ihm und Ford eine beängstigende Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit auf.
„Mindhunter“ ist ein unaufgeregter psychologischer Dialogthriller, der dankenswerterweise blutige Szenen weitestgehend ausspart. Das Kopfkino des Zuschauers während dieser detaillierten Interviews lässt sich allerdings nicht so einfach ausschalten.
Stefan Turiak
[amazon_link asins=’1501179969,B00EQZJMQS,B00FLRP8UE,B073VPKRS4′ template=’ProductCarousel‘ store=’lesezeichenr-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’ae580bf3-b8fa-11e7-95f5-0ba59bb9fd24′]

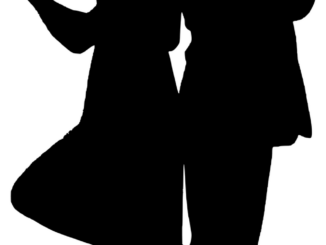


Hinterlasse jetzt einen Kommentar